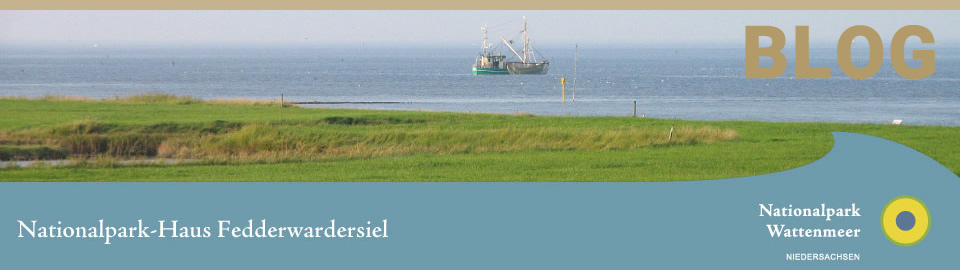Wenn die Tage kürzer werden und der Wind an Stärke zunimmt, verwandelt sich das Wattenmeer und scheint in eine Art Winterschlaf zu fallen. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Ganz still ist es hier nie. Unter der Oberfläche und zwischen den Prielen pulsiert auch jetzt das Leben.

Für die vielen verschiedenen Tierarten, die im Watt heimisch sind, ist der Winter eine Herausforderung- aber sie sind bestens angepasst. Wattwürmer graben sich zum Beispiel tief in den feuchten Boden ein, wo die Temperaturen gleichmäßiger sind. Genial ist die Methode der Herzmuscheln. Ihre Körperflüssigkeit enthält eine Mischung aus Salzen und Eiweißen, die wie ein Frostschutzmittel den Gefrierpunkt in den Zellen absenkt. Andere Muschelarten hingegen schließen fest ihre Schalen und überstehen so Frost und Sturm. Wieder andere Tiere des Wattenmeeres wie die Scholle oder auch die Strandkrabbe ziehen sich zum Schutz vor der Kälte einfach in tiefere und damit frostfreie Bereiche der Nordsee zurück.
Richtig rund geht es im Winter bei den Kegelrobben. Sie gebären zwischen November und Anfang Januar ihre Jungen. Die imposanten Verwandten der Seehunde sind die größten in Deutschland lebenden Raubtiere.

Auch der Himmel über dem Watt bleibt belebt: Viele Zugvögel, die weiter nördlich brüten, verbringen den Winter an der Nordseeküste. Zu den häufigsten Wintergästen gehören z.B. Pfeifente, Brandgans und Alpenstrandläufer. Für sie ist das Wattenmeer kein karger Ort, sondern eine lebenswichtige Zwischenstation, oder sogar ihr Winterquartier. Bei Ebbe ist das Watt für sie wie ein gedeckter Tisch. Im feuchten Schlick wimmelt es von Wattwürmern, kleinen Krebsen, Muscheln und Schnecken- eine ideale Energiequelle für zahlreiche Arten.
Doch frieren die Vögel bei diesen kalten Temperaturen den gar nicht? Nein, sie frieren nicht. Sie haben im Winter kalte Füße – und das aus gutem Grund. Über ihren Blutkreislauf senken sie die Temperatur in ihren Füßen bis auf null Grad ab. Das ist für sie in dieser Zeit lebensnotwendig. Ansonsten würden sie über die Beine viel mehr Wärme abgeben, als sie wieder ersetzen könnten. Zum anderen sorgen kalte Füße dafür, dass das Eis nicht antaut, sonst würden sie anschließend daran festfrieren.

Und auch das Schwimmen in eisigem Wasser ist für Enten, Gänse und Co. kein Problem. Sie lassen das kalte Wasser gar nicht erst an die Haut heran: Dabei hilft die Bürzeldrüse über dem Schwanz, die bei Wasservögeln stärker ausgebildet ist als bei den Verwandten an Land. Diese einzige Hautdrüse der Vögel scheidet ein fettiges Sekret aus. Regelmäßig “nippen” Wasservögel daran und ölen dann ihr Gefieder mit dem Schnabel regelrecht ein. So bleibt es wind- und wasserdicht.
Doch für die Vögel ist diese Zeit kein Urlaub. Der Körper der Vögel produziert aktiv Wärme in den Muskeln und in den verschiedenen Organen, besonders in der Leber. Die Wärme wird über das Blut im Körper verteilt. Da über die Körperoberfläche aber viel Wärme an die Umgebung abgegeben wird, kühlt der Körper aus. Wer viel Energie abgibt, muss auch viel Energie über die Nahrung aufnehmen. Daher brauchen die Vögel jede ruhige Minute, um Fettreserven zu bilden und Kräfte zu sparen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die vielen Vögel im Nationalpark im Winter große ungestörte Bereiche vorfinden, denn wenn sie aufgeschreckt werden und wegfliegen, verbrauchen sie unnötig Energie – etwa 8-10 mal so viel, als wenn sie einfach nur ruhig sitzen oder fressen.

Winterzeit bedeutet aber auch Zeit der Stürme. Was für uns oft ungemütlich erscheint ist für das Wattenmeer Teil seines natürlichen Rhythmus. Wind und Wasser sorgen ständig dafür, dass sich Sandbänke verlagern, Priele ihre Richtung verändern und an manchen Stellen Land abgetragen wird, was an anderen aufgetragen wird. Watt, Salzwiesen und Deiche bilden so gemeinsam ein natürliches Schutzsystem, das nicht nur Tieren, sondern auch uns Menschen zugutekommt. An besonders kalten Tagen bildet sich eine dünne Eisschicht, die sich mit jeder Tide bewegt, bricht und neu formt. Dieses sogenannte „Treib- oder Schillereis“ erzeugt faszinierende Muster und Geräusche, wenn Eisschollen aneinanderstoßen oder vom Wasser getragen werden.
Wer jetzt im Nationalpark unterwegs ist, kann die Stille genießen- und gleichzeitig helfen, sie zu bewahren: Bleibt also bitte auf den Wegen, haltet Abstand zu den Tieren und lasst die Natur einfach Natur sein.