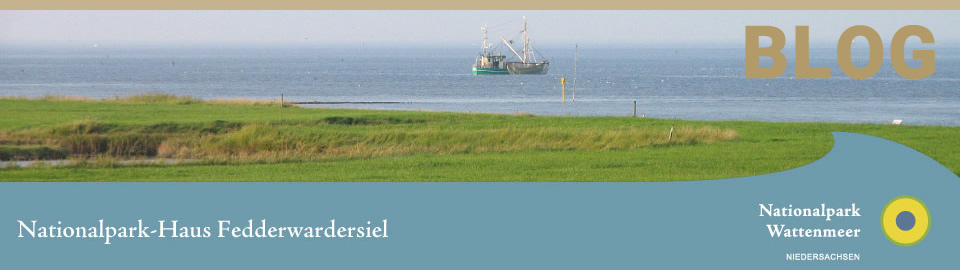Warum sind Seegraswiesen wichtig?
Die Seegraswiesen sind Lebens- und Rückzugsraum zahlreicher Meerestiere. Jungfische, Kleinlebewesen und wirbellose Lebewesen finden dort Nahrung und Schutz. Sie stabilisieren den Wattboden, indem ihre Wurzelsysteme die feinen Sedimente festigen. Das hilft, Küstenbereiche und Wattstrukturen zu erhalten. Im Wattenmeer kommen hauptsächlich zwei Seegrasarten vor- das große Seegras (Zostera marina) und das Zwerg-Seegras (Zostera noltii). Seegraswiesen haben eine große Bedeutung für den Klimaschutz, indem sie Kohlenstoff binden und dazu beitragen, CO2 aus dem Wasser und der Atmosspäre zu speichern. Sie haben also eine sogenannte „Blue Carbon“- Funktion.
Der aktuelle Bestand im Wattenmeer
Bei der letzten großen Bestandsaufnahme der Seegraswiesen an der niedersächsischen Küste 2019 wurde eine Gesamtfläche von nur rund 8,6km2 erfasst. Im Vergleich zu 2013 entspricht das einem Rückgang von über 70%. Auch wenn der Rückgang nicht gleichmäßig verteilt ist und einige Bereiche sogar eine leichte Erholung zeigen, verschwinden die Seegraswiesen an anderen Stellen fast vollständig.

Warum verschwinden die Seegraswiesen?
Um den Rückgang der Seegraswiesen nachvollziehen zu können, sind mehrere zusammenhängende Faktoren zu beachten. Zum einen braucht Seegras viel Tageslicht, um ausreichend Fotosynthese betreiben zu können. Wenn das Wasser durch Schwebstoffe oder Sedimentsverwirbelungen getrübt wird, kommt zu wenig Licht am Boden an und die Pflanzen sterben ab. Durch die Eutrophierung aus Landwirtschaft oder Abwässern wird das Wachstum von Algen gefördert, die sie als Teppich über die Seegrasblätter legen und ihnen das Licht nehmen. Der Klimawandel sorgt dafür, dass sich das Wasser erwärmt und die Strömungen verändern. Auch Muschelfischerei kann den Meeresboden aufwirbeln und somit die Seegraswiesen schädigen.

Was bedeutet das für das Wattenmeer?
Durch den Rückgang der Seegraswiesen verlieren viele Arten ihre Schutz- und Futterplätze. Durch weniger Seegras kann weniger CO2 gespeichert werden und somit weniger natürlicher Klimaschutz geleistet werden. Zudem lockert sich der Boden immer stärker, was langfristig Küstenschutz und Wattdynamik beeinflusst.

Was können wir dagegen tun?
Um die Seegrasbestände effektiv zu schützen, kann die Wasserqualität mithilfe von besseren Kläranlagen und weniger überschüssigen Nährstoffen verbessert werden. Mit Monitoring zur besseren Erfassung der Veränderungen, Projekten zur Wiederansiedlung von Seegras und Klimaanpassungsmaßnahmen können wir dafür sorgen, dass dieser besondere Lebensraum wieder stabilisiert wird.
Betretet also die Wattflächen mit besonderer Vorsicht, reißt das Seegras nicht raus und nehmt eure Hunde in den ausgewiesenen Schutzgebieten an die Leine, um die Naturschutzzonen zu respektieren.